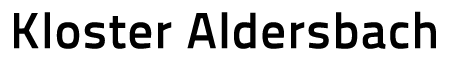- Vorbemerkungen
- Hauptquartier Aldersbach (WD)
- Pleinting (WD)
- Devotionsbild Buchenöd
- Devotionsbild Osterhofen
- Winterquartiere 1742/43
- Lagebericht Vilshofen 1743
- Bericht: Eroberung Vilshofens (WD)
- 2. Bericht (Scharrer)
- 3. Bericht (Chaffat)
- Bildgalerie Vilshofen
- "Bayrischer Krieg" Gemälde von J.G. Kaiser
- Kloster St. Salvator
- Abt Paulus Genzger
- Karten und Ansichten
- Niederaltaich 1742-45
- Gesamtbericht 1742 Niederbayern (WD)
Der Österreichische Erbfolgekrieg und die Auswirkungen auf das Kloster Aldersbach und sein Umland (1741-45)
von Robert Klugseder
Der Aldersbacher Mönch und Chronist P. Michael Mannstorff beschreibt die Auswirkungen des Österreichischen Erbfolgekrieges auf das Kloster und die Untertanen während des Abbatiats von Paulus Genzger (reg. 1734-45) folgendermaßen:
> Es fangte Anno 1741. der schädliche Krieg an, welcher gar bald dem Closter sehr empfindliche Wunden versetzet hatte, worvon ein ganzer Tractat zu schreiben wäre; dann zu geschweigen, das 2 mahl das Haupt-Quartier, und folglich etliche 1000 Mann mit Officiers und deren Anhang von hieraus zu verpflegen, auch andere kostbare gantze Winter-Quartier zu ertragen waren, so muste das Closter nebst Ansehung des Ruin viler Unterthanen annoch grosse Contributionen an paaren Geld præstiren, welche, und mehr andere Verdrüßlichkeiten gedachtem Abbten [Paulus Genzger] also zu Hertzen drungen, das er besser fande der Abbteylichen Sorgen frey zu seyn, resignirte also die Abbteyliche Würde in die Hände des dermahligen Hochwürdigen und Gnädigen Herrn Prælatens zu Ebrach, welcher als Pater Immediatus, und zugleich Vicarius Generalis totius sup. Germaniæ dises Closter visitirte, und bey darauf erfolgter Wahl præsidirte. Entzwischen begabe sich Abbt Paulus nacher Samarey, allwo er auch den 20. Februar des jetzt lauffenden Jahrs nach empfangenen Heiligen Sacramenten im Herrn entschlaffen.
Niederbayern war von Juli 1741 (Eroberung Passaus) bis zum (Partikular-) Frieden von Füssen zwischen Bayern und Österreich im April 1745 fast durchgehend von massiven kriegerischen Handlungen und Truppenbewegungen bzw. Stationierungen betroffen. Neben den direkten Verwüstungen belastete die Versorgung der österreichisch-ungarischen-kroatischen und französisch-bayerisch-hessischen Truppen, die in der Region auch ihre Winterlager aufgeschlagen hatten, die Bevölkerung erheblich. So verbrachten im Winter 1742/43 "2 Regimenter Cavallerie, und darzu gehörige Herrn Pavoye et Preysing" im Kloster und in der Hofmark Aldersbach. In den Wintermonaten der Jahre 1743/44 war das 8. Habsburgische Infanterie-Regiment unter dem Kommando des Generalfeldmarschalls Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen mit etwa 2000 Mann hier stationiert. Die Auswirkungen auf das Vilstalkloster scheinen sich im Vergleich zu frontnahen Konventen (wie z.B. auf die schwer in Mitleidenschaft gezogenen Niederalteich und Osterhofen) in Grenzen gehalten zu haben. Im Gegensatz zu einigen benachbarten Klöstern, die gebrandschatzt worden waren (wie z.B. St. Salvator, vgl. das Bittschreiben des Abtes an Kaiser Karl VII.), verfügte Aldersbach über ausreichend Kapital, um Schutzgelder (Kontributionen) zahlen zu können. Die zunächst gut gefüllten Kornkammern und die Wein- und Bierkeller des Klosters boten jedoch auch einen Anreiz für durchziehende Truppen, hier auch für längere Zeit zu verbleiben. So befand sich im Jahr 1742 für mehrere Wochen ein Habsburgisches Hauptquartier in Aldersbach. Im Kriegsarchiv Wien zeugen etliche Berichte des Generalfeldmarschalls und Oberkommandierenden der Armee an der Donau Graf Ludwig Andreas von Khevenhüller an den Hofkriegsrat Wien von dessen Aufenthalten in Aldersbach vom 24.04.-16.05.1742 und am 29.11.1742. Die Tagebucheintragungen des Niederalteicher Abtes Marianus Pusch, die hier als Teiltranskription zur Verfügung stehen, vermitteln einen grausamen Eindruck von den verheerenden Auswirkungen des Krieges auf das durch seine geographische Lage an der Donau und durch seine Grenznähe zu den beiden kriegsführenden Parteien besonders betroffene Kloster der heiligen Mauritius und Godehard. Die Einquartierungen in Aldersbach werden in ähnlicher Form stattgefunden haben.
Von einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Nähe des Klosters berichtet die Münchner Zeitschrift "Mercurii Relation, oder wochentliche Ordinari Zeitungen von underschidlichen Orthen" vom 20.04.1743:
> Extract eines Schreibens von dem Herrn Obrist-Lieutenant von Escher an Seine Excellentz den Herrn Marschall von Seckendorff. Arnstorf den 29. Mertz.
> Euer Excellentz habe die Ehr zu berichten, daß die österreichische Frey-Compagnie disen Morgen bey Allersbach von unsern Husaren in Stücken gehauen worden, und nicht mehr als 4. Mann davon echapirt seynd, die zwey Officiers, so dieselbe commandirt hatten, seynd auch gebliben, es haben unsere Leute nur ein Pferd verlohren, und eines ist bleßirt worden. Nach dem Befehl, so ich ihnen ertheilet, haben sie nur einem eintzigen Ungar Quartier gegeben, welcher sehr biezirt ist. Ich lockte sie in die Oeffnung des Gebürgs / und wie sie dieselbe paßirt waren, besetzte unsere Frey-Compagnie die Passage, worauf sie von unsern Husaren in der Ebene angegriffen worden.
Vom 09. auf den 10.11.1744 (und damit wenige Wochen vor seinem Tod am 20.01.1745) nächtigte der Wittelsbacher Kaiser Karl VII. Albert, Kurfürst und Herzog von Bayern, und eine 36.000 Mann starke bayerische Armee im Kloster Aldersbach. Bevor der Kaiser nach Vilshofen weiterzog, feierte er in Aldersbach die hl. Messe. Im Aldersbacher Taufbuch finden sich für die Zeit von November 1744 bis Januar 1745 auch etliche Eintragungen für Neugeborene von "Soldatenvätern" sowohl der bayerischen als auch der österreichischen Armee. Auch im Totenbuch finden sich für diese Zeit einige verstorbene Soldaten verschiedener Nation.
Die hier zur Verfügung gestellten Archivalien und Abhandlungen bieten einen ersten Überblick über die Geschehnisse dieser Jahre. Bisher kaum beachtetes Bildmaterial aus dem Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs Wien bietet zudem eindrucksvolle visuelle Eindrücke (u.a. Ortsansichten, Lagekarten und Karten von Truppenbewegungen).
Eine lesenswerte Einführung in die Thematik bietet der Vilshofener Chronist Franz Seraph Scharrer in seiner Stadtgeschichte (Chronik der Stadt Vilshofen von 791-1848, Vilshofen 1897, mit Anmerkungen und Ergänzungen von Karl Wild, Neuausgabe 1984). Eine Beschreibung der Eroberung der Stadt im Jahr 1745 findet sich in einem separaten Kapitel (-> 2. Bericht Scharrer):
"Kaiser Karl VI. hatte keinen männlichen Erben. Damit seine Länder der Tochter Maria Theresia zufielen, ernannte er diese in einer von den meisten europäischen Staaten bekräftigten, die pragmatische Sanktion geheißenen Urkunde zu seiner Nachfolgerin. Der Kurfürst Karl Albrecht von Bayern, wie auch der König von Preußen waren den anderen Mächten nicht beigetreten, sie glaubten Ansprüche auf Teile der österreichischen Monarchie zu haben. Frankreich betrachtete ebenfalls die pragmatische Sanktion nur mit Widerwillen und schloss mit dem bayerischen Kurfürsten ein Schutz- und Trutzbündnis am 18. Mai 1741. Wir lesen alsobald von Aushebungen der Mannschaften in Bayern. Der Stadtschreiber in Vilshofen muss zweimal zur „Musterungscommission des Landfahnens mit den hiesigen Ausgewählten, auch jungen Bürgern und Bürgerssöhnen nach Osterhofen reisen;“ das Geschäft dauert immer zwei Tage. Von den in Osterhofen Gemusterten wurden zwölf hiesige Bürgerssöhne nach Eschlkam zum Schutze der Grenze auf die „Postirung“ im Frühsommer 1741 beordert.
Der Krieg nahm seinen Anfang mit der Besetzung der Stadt Passau durch den bayerischen General Grafen von Minucci am 31. Juli 1741. Die versprochenen französischen Hilfstruppen kamen auf ihrem Zuge nach Österreich im September durch Vilshofen. Sie kampierten auf dem Bürgerfelde, drei Bräuer, welche für sie, obgleich der Kämmerer es ihnen schaffte, kein Bier lieferten, wurden um 6 Gulden gestraft. Den Franzosen, von denen zwei hier begraben wurden, dienten 10 Tage durch als Dolmetscher der Krämer Johann Michael Pelleth von Garham und der ins Pfleggericht eingeschaffte, abgedankte bayerische Hauptmann de Montprisson. Jeder erhielt des Tages 45 Kreuzer und hatte außerdem freie Station. Im Januar 1742 kehrten die Franzosen, da sie in Österreich sich nicht länger halten konnten, über Vilshofen zurück. Um ihnen Platz zu machen, verließen drei Kompagnien des Generallieutenant-Graf-Piosagueschen Dragonerregiments, von denen eine schon am 27. Dezember eingerückt war am 7. Januar die Stadt.
Gerade am 7. Januar (1742) eroberte der österreichische General Bernklau, nachdem er schon vorher Ried besetzt hatte, die Stadt Schärding. Nachrichten von dem Vorrücken der Feinde gegen das Innviertel waren schnell nach Vilshofen gelangt, sichere Kundschaft einzuziehen, hatte man von hier mehrere Boten ausgesendet.
„Am 13. Januar zur Nachtzeit drang der österreichisch-hungarische Husarenoberstlieutenant Herr von Mentzl mit einem Corpo (Corps) in hiesige Stadt ein“ wie es an einer andern Stelle der nämlichen Vilshofener Kammer- oder Gemeinderechnung von 1741 und 1742 heißt: „er überrumpelte sie, und nahm sie ohne gehabte Gegenwehr und gewußten Succurs ein,“ welch letztere Worte so viel bedeuten, daß man an einen Widerstand um so weniger denken konnte, als von keiner Seite her eine Hilfe zu erwarten war.
Klämpfl berichtet: „Es wären Landfähnler in der Stadt gelegen, welche die Gewehre und selbst die Kleider weggeworfen hätten. Auch leisteten die Bürger keinen Widerstand, sie öffneten die Tore und überbrachten die Schlüssel. In der untern Vorstadt habe der Posthalter, ein geborener Österreicher (er hieß Georg Gärber und 244 stammte von Lambach), den Kroaten Hacken gegeben, daß sie den Schrankbaum von seinem Hause“ zerhieben.“ Wir wissen nicht, aus welcher Quelle diese Angaben geschöpft sind, und tragen noch folgende desselben Schriftstellers nach: „Diese Ergebenheit der Bürger besänftigte die wilden Krieger nicht, sobald sie in die Stadt traten. fingen sie sogleich mit Ungestüm und Wut zu plündern an und als sie von ihrem Anführer daran gehindert wurden, machten sie die schwersten Erpressungen und gaben sich den schändlichsten Ausschweifungen hin“.
Bestätigung findet der erste Teil dieser Nachricht in den Worten der Kammerrechnung, „Daß die angefangene Plünderung eingestellt werde, verehrte die Stadt dem Herrn von Mentzl 100 Dukaten = 425 Gulden, demnach etwas mehr als 700 Reichsmark; auf seine Verpflegung und auf Geschenke für seine Bedienstete gingen außerdem weit über 100 Gulden auf.“ Wenn Klämpfl sich ferner auslässt: Jedoch schon am 14. Januar flohen jene wilden Krieger, als sie eines bayerischen Soldaten ansichtig wurden, so steht dies, nicht zu reden von weiter unten mitzuteilenden Tatsachen, mit der ausdrücklichen Angabe hiesiger Registratur in Widerspruch, gemäß welcher nach Ausmarsch des Herrn von Mentzl am 16. Januar der Husarenrittmeister Popowiz und am 24. Januar Rittmeister Modaschawiz österreichische Kommandanten in Vilshofen werden.
Auch weiß Klämpfl nichts darum, dass der berüchtigte Pandurenoberst Trenk am 28. Januar hier einmarschierte, freilich durch Befriedigung seines Begehrens von Portionsgeldern im Betrage von 80 Gulden 40 Kreuzer sich bewegen ließ, kein Quartier zu nehmen. In Anbetracht jenes Datums kann der Angriff auf Deggendorf oder die Besitznahme dieser Stadt durch Trenk nicht auf den 20. Januar fallen, wie Buchner in seiner bayerischen Geschichte annimmt; jedenfalls trifft Klämpfl, welcher den 3. Februar hat, das Richtige oder wenigstens das Richtigere,
Von Schärding aus hatte General Bernklau unter Androhung von Feuer und Schwert an hiesige Stadt die Aufforderung gestellt, Bürger abzuordnen, um „mit denselben ratione (bezüglich) der abbegehrten Kontribution oder Brandsteuer Akkord zu machen (sich ins Benehmen zu setzen)“. Der Rat wählte hiefür einen aus seiner Mitte den Weingastgeber Johann Haas (Stadtplatz 38, jetzt Buchdruckerei) — und den Stadtschreiber Johann Rudolf Braunschober, welche dann solches ist der Laut des Vortrags in der Kammerrechnung - „den 16. Januar nachts unter Begleitung zweier Husaren fortgefahren und zu Fürstenzell eingekehrt, den 17. aber in der Nacht aufgebrochen; da nun, wie man gegen Schärding hinzu gekommen, der kurfürstliche Generalfeldmarschall Graf von Törring-Jettenbach diese Stadt angegriffen und beschossen, — es war dies eben der 17. Januar - haben sich die beiden (österreichischen) Husaren verloren, Herr Haas und der Stadtschreiber sind nach Vornbach, von dort nach Neuburg gefahren und am 18 durch den Neuburger Wald, indem sie, einen reitenden Wegweiser mitnahmen, wieder nach Vilshofen zurückgekehrt.“ Klämpfl weicht auch hier ab, indem er die zwei Deputierten mit Gewalt gegen Schärding führen lässt.
Klämpfl gesellt den zwei bürgerlichen Deputierten auch einen Geistlichen, den Otto Dalhofer, bei. Die magistratischen Aufzeichnungen schweigen über ihn. Er war nämlich nicht von der Stadt abgesendet, sondern als Vermittler vom Chorherrnstift, welchem ja auch eine Brandschatzung war aufgelegt worden.
In der Vorhalle unserer Mariahilfkapelle, rechterseits und zu oberst hängt eine große Votivtafel mit dem Datum 17. März 1742. Im Hintergrunde ist Schärding mit seinen Mauern und Basteien, Kirchen und Türmen zu gewahren, vor der Stadt ist im Halbdunkel ein Gefecht dargestellt, im Vordergrunde ein Trupp Reiter, von denen zwei rechts und links an eine mit drei Pferden bespannte Kalesche sich drängen und den darin sitzenden, als solcher an seiner Kleidung zu erkennenden Geistlichen mit vor die Brust gesetzter Pistole und mit geschwungenem Säbel bedrohen. Der Kutscher in bäuerlicher Tracht ist abgestiegen und bittet einen Reiter, der das Schwert über ihn erhoben hat, mit gefalteten Händen um Schonung des Lebens. Links unten auf der Tafel ist neben dem angegebenen Datum ein Wappen und das Monogramm L.A.O.D. zu sehen. Aufklärung gibt folgende Inschrift auf der Rückseite: „Der hilfreichen Vorbitt Mariae zu immerwehrenten Danch ist den 17. Jener 1742 vor Scherding aus mehr(ern) augenscheinlichen Leib und Lebensgefahren ganz unverletzt davon kommen Ludwig Anton Otto Dalhofer32, Chorherr und P.T. Stadtpfarrer allhier.“ Damit ist bezeugt, dass Dalhofer im Namen des Kapitels deputiert und bis gegen Schärding, also weiter als die zwei Bürger eskortiert wurde. Das Treffen vor der Stadt führte für kurze Zeit den Entsatz herbei. Die Buchstaben P.T. sind die Abkürzung für: Pro Tempore, auf Deutsch: zur Zeit. Die Chorherren zu Vilshofen wechselten in der Verwaltung der Pfarrei. Mit leicht verzeihlichem Fehler legt ihm Klämpfl schon damals den Titel Propst bei. Dalhofer wurde es erst später, es lebte noch sein Vorgänger Schappberger bis zum 12. Juli 1742.
Die Vilshofener hatten wohl gehofft, von ihrem Dränger Bernklau, dessen Name schon nicht geheuer erscheinen mochte, befreit zu sein. Aber schnell erbleichte der Hoffnungsstrahl. Der bayerische Feldmarschall wurde von Schärding unter großen Verlusten „weggeschlagen und der österreichische General ließ der Stadt Vilshofen eine neue Zitation unter schärfster Bedrohung zugehen. Zwei Bürger, Gastgeber Jos. Anton Prunner, des innern (Stadtplatz 24) und Nikolaus Prechtl, Sattler, des äußeren Rates (Stadtplatz 28) gingen nach Schärding. Die Contribution ward auf 2000 Gulden festgesetzt und dazu mussten sie - eine hämische Beschwernis, die aber in diesem Kriege nicht vereinzelt dasteht - als Aufzählgeld 100 Gulden entrichten. Den General selbst verehrten sie 24 Carolin á 9 Gulden 30 Kreuzer, dem Kriegskommissär König, damit nicht noch Nachforderungen über jene Contribution kämen, 425 Gulden und halb soviel darnach, „weil er's dahin gebracht, dass es bei berührter Contribution gänzlich geblieben, auch weil er versprochen hat, so viel er kann, Gutes zu erweisen,“ dem Bedienten, „damit man allenthalben einen guten Zutritt gehabt,“ an Trinkgeld 13 Gulden 21 Kreuzer. Letztere Art von Schmieralien scheint zu allen. und sonderlich in diesen Zeiten gang und gäbe gewesen zu sein. Des Generals Bernklau Adjutanten hatte man schon am 21. Januar 12 Dukaten á 4 Gulden 15 Kreuzer, damit er die hiesige Stadt bei seinem Chef „gut anschreiben“ möchte, verehrt und ihn, wie sich wohl selbst versteht, mit Speis und Trank auf das beste gehalten. Wir vermuten, dass er eben damals die zweite Vorladung des Generals überbracht habe. Die Deputierten hatten kein Geld oder so viel nicht bei sich. Der eine wurde, wie es scheint, als Geisel zurückbehalten und musste mit Bernklau sich gegen Passau begeben, das der General erobern wollte und auch sogleich in seine Gewalt bekam. Der andere, Prechtl, fuhr, um das Geld zu holen, von Schärding nach Vilshofen. Es ist ein Wunder, dass sich in den harten Zeiten Gläubiger fanden, die schnell und gegen mäßige Zinsen, zu 4% einige Tausend Gulden vorstreckten. Eine Bräuerswitwe in Schärding, Helena Schärl, lieh außerdem noch 400 Gulden her, weil die mitgebrachte Summe kein „Klecken“ hatte. Die Daten stimmten ganz gut zusammen. Buchner setzt das Erscheinen Bernklaus vor Passau auf den 25. Januar und am nämlichen Tage stellte der Magistrat von Vilshofen an obige hilfreiche Gläubiger die Schuldurkunde aus. Von dieser Brandschatzung schweigen Klämpfl und andere Schriftsteller gänzlich, was mit auch ein Grund ist, warum wir diese Tatsachen veröffentlichen.
Mit Eintritt der rauhen Jahreszeit 1742 verzichtete man auf die Kriegsführung in größerem Maßstabe. Die verbündeten Franzosen und Bayern hielten mehr als die Hälfte von Niederbayern besetzt; die Österreicher lagen in der Linie von dem damals noch bayerischen Markte, jetzt Stadt Ried bis Grafenau. In dieser Linie war auch Vilshofen inbegriffen. Doch wurde Ende Dezember das österreichische Kommando von hier nach Sandbach zurückgezogen. Der Abt Marian zu Niederalteich tadelt den französischen General Broglio, dass er, obgleich oftmals gemahnt, unter allerlei Vorwänden sich weigerte, in unsere von den Österreichern verlassene Stadt eine Besatzung zu werfen, was später der ganzen Umgebung diesseits und jenseits der Donau zu nicht geringem Nachteil ausgeschlagen habe. Die Österreicher nahmen gegen Ende März wieder Besitz von Vilshofen.
Von solchen Truppenabteilungen, welche dem Feinde am nächsten stehen, sagt man, sie befänden sich auf Postierung. Deshalb lesen wir in dieser Zeit von der „Postirung“ in Sandbach, von der „Postirung“ in Vilshofen. Die Häuser hier waren mit Soldaten überfüllt; neu ankommende konnte man bei Privaten nicht unterbringen. der Magistrat legte sie in Wirtshäuser und vergütete für den Mann per Tag 4 Kreuzer aus der Stadtkasse. Kranke, Blessierte mussten oft längere Zeit verpflegt werden. Gefangene wurden zum Behufe der Auswechslung auf- und abwärts geführt. Auch gab es trotz des Winters Durchzüge. Einmal kommen 950 Mann, ein anderes Mal reiten 150 österreichische Husaren ein. Husaren waren es, vielleicht einige von eben diesen 150, welche in den „bürgerlichen Mühlen“ hier plünderten. Der Magistrat schickte einen aus seiner Mitte mit einer Dank- und Bittschrift nach Passau an den österreichischen General Brown (sprich Braun), dass solches für die Zukunft eingestellt werde. Bedrängnisse fielen oft auf einen einzigen Tag in der Art, dass sie in der Jetztzeit für ein ganzes Jahr zu reden geben würden.
Den hier kommandierenden Offizieren mussten ansehnliche Tag- oder wie man sie hieß, Diskretionsgelder gegeben werden, 2,3 Maxdore (á 12 Mk.), auch den unter ihnen stehenden Subalternoffizieren. Manches schöne Sümmchen pressten sie dem Stadtrate durch Drohungen ab, einer 50 Dukaten, er hatte aber noch so viel verlangt dafür, dass er nicht plündern lasse, ein anderer über 100 Gulden, dass er die Vilsbrücke nicht abbrenne.
Während der Monate Januar und Februar und größtenteils noch im Monat März war Vilshofen wohl mit keinem ständigen Quartier beschwert, es musste aber die Stadt allerlei Lieferungen für die Offiziere der Postierung zu Sandbach auf sich nehmen. Der Magistrat machte wohl Vorstellungen, dass Sandbach nicht unter die Stadt, sondern unter das Pfleggericht gehöre. Aber es half nichts, schon darum wurden die Gerichtsuntertanen nicht in Mitleidenschaft gezogen, weil die Pflegbeamten sich geflüchtet hatten. Namentlich hatte die Stadt viel Wein nach Sandbach zu schicken, die Maß Österreicher kostete damals 24 Kreuzer, ferner auch Fleisch, Kalbfleisch immer viertelweise, dann öfters ein Lamm, das auf ungefähr 1 Gulden 30 Kreuzer zu stehen kam, Spanferkel3, 1 Rehschlegel (2 Gulden), manches Federwild so mehrere „Bändl Vögel“ unter denen einmal die Krammetsvögel genannt werden, Würste, Karpfen, Käse, Brot, Mehl.
Unterm 18. März 1743 berichtet Prälat Marian von Niederalteich, dass die bayerischen Husaren und die (bayerische) Freikompagnie mit den Königlichen (das ist mit den Österreichern) zu Vilshofen schar mützelten und dass die Österreicher in die Flucht geschlagen worden seien. Vielleicht war doch nicht viel dahinter. Die Stadtrechnung meldet uns, dass an jenem Tage bayerische Husaren eingeritten sind und man ihnen für 3 Gulden 30 Kreuzer Brot habe reichen müssen, und dass am nämlichen Tage noch General Brown von Passau seinen Adjutanten nebst einem andern Offizier hierher abordnete und von der Stadt 600 Gulden forderte, weil die bayerischen Husaren in Vilshofen eingefallen und zwei österreichische Reiter blessiert haben. Der Magistrat machte die nachdrücklichste Vorstellung, „daß man bei gemeiner Stadt von diesem nicht die mindeste Wissenschaft gehabt, consequenter (folglich) ohne alle Schuld sei, dennoch hergeben müssen 400 Gulden.“ Dass der General Nachlass gewährt hat, brachte ein Magistratsrat den Dank und noch ein „Kuchelpräsent“ nach Passau. Selbstverständlich mussten der Adjutant und sein „Konsorte“ mit „bei sich gehabten Leuten“ hier zehrungsfrei gehalten werden.
Mit dem Essen kommt der Appetit, sagt ein französisches Sprichwort. Kaum zwei Tage waren vergangen, erscheint der nämliche Adjutant mit dem Begehren seines Generals, man solle diesem 1000 Taler Winterportionsgelder bezahlen, weil er nicht hier, sondern in Passau, wo er ein Haus besaß, Quartieraufenthalt genommen habe. Lassen wir hierüber den, welcher die Kommunalrechnung stellte, weiterreden: „Der Adjutant machte den Beisatz, dass wenn man sich nicht gleich akkommodieren (darein geben) werde, „die Sache nicht so leicht abgemacht werden könnte, wo man ihn Herrn Adjutanten zum Patron erbeten und demselben geben 100 Gulden Darüber hin schickte man Gastgeber Brunner und Sattler Prechtl (zwei Ratsherren, letzterer Stadtplatz 28) mit, um die Anforderung möglichst herab zu bitten, die es endlich über getane nachdrucksamste Vorstellungen heruntergebracht so auch erlegt worden auf 670 Gulden.“ Der General hat denn doch mit sich über die Hälfte herabhandeln lassen.
Uns dünkt, bezüglich der Verwundung der beiden Reiter sei man in Niederalteich nicht genau unterrichtet und so der Vorfall zu einem Scharmützel aufgebauscht worden. Aber schon wieder für den 21. März meldet Abt Marian „ein scharfes Zusammentreffen beider Parteien daselbst“ (zu oder nächst Vilshofen). Wir wissen hierüber keinen weiteren Aufschluss zu geben. Zum 11. April schreibt Marian in sein Tagebuch: „Daß neuerdings Bayern und Ungarn bei Vilshofen zusammentrafen, wobei die letzteren viel verloren und bis in die Stadt verfolgt wurden. Das (bayerische) Freikorps, welches meistenteils um Göttersdorf, Haidenburg und Arnsdorf stationiert war, würde großen Vorteil über die Ungarn errungen haben, hätten die Franzosen ihm sekundirt (mitgeholfen), allein diese waren meistens nur spectatores (bloße Zuschauer).“ Der 13. April führte einen Zusammenstoß bei Pleinting herbei. Von den Ungarn oder Österreichern blieben gegen 130 Mann ohne die Gefangenen am Platz, berichtet Marian, und setzt dazu, dass die Feinde abermals bis in die Stadt verfolgt wurden. Welchen Schrecken werden in diesen Tagen die Vilshofener ausgestanden haben, insbesondere Kinder, Frauen. ältere Leute! Die letzerwähnte Affäre muss doch bedeutend gewesen sein. Die Stadtrechnung erwähnt zufällig, dass vier österreichische Offiziere hier begraben wurden, im pfarrlichen Totenbuch sind sie aber nicht eingetragen und umso weniger die gemeinen Soldaten. Damals lagen schon wieder Österreicher hier; sie hatten die Stadt am 25. März besetzt.
Die Gemeindekasse Vilshofen hat im Etatsjahre 1742/43, von Georgi bis Georgi, 8441 Gulden 30 Kreuzer, abgesehen von den Belastungen der einzelnen Bürger, ausgegeben und es war darum gerechtfertigt, wenn der Magistrat an die Regierung zu Landshut sich wendete, klagend, dass es bei dermaligen Kriegsläuften der Stadt härtest ergehe und um gnädigste Remadur (Abhilfe) bat. Aber Regierung und Landesherr, nämlich der Kurfürst Kaiser Karl Albrecht, konnten sich selbst nicht helfen. An Kapitalien hatte die Kommune Vilshofen im selben Jahre 9430 Gulden aufgenommen.
Am 26. April schlugen die Österreicher in Vilshofen eine Schiffbrücke, wozu das Material aus den untern Gegenden heraufgebracht worden war. Auch arbeiteten sie den Monat April durch auf das Fleissigste an der Verschanzung der Stadt. Die Werke zu besichtigen, kam General Brown am 19. April aus Passau, kamen vor ihm schon andere Offiziere. Noch im Monat Mai ist ein österreichischer Ingenieurlieutenant drei Wochen hier.
Die Österreicher hatten den Feldzug 1743 mit vielem Glücke eröffnet und blieben Herrn vom ganzen Bayerland. Vilshofen war den Sommer und Herbst über von feindlichen Kommandos besetzt. deren Befehlshaber den Bürgern allerlei Heimsuchungen bereiteten; dabei ein fortwährendes Ab- und Zugehen anderer österreichischer Öffiziere auch vom höchsten Rang, Durchmärsche verschiedener Truppenabteilungen, Einquartierungen von gefangenen Österreichern und Franzosen, Verpflegung von Kranken!
Am 24. November 1743 rückte hier ins Standquartier ein der Oberst des österreichischen Graf-Kolowrat'schen Infanterieregiments, Klaudius von Sincère, seiner Geburt oder seiner Abstammung nach ein Franzose. Sein Name gibt sich im Deutschen als: Aufrichtig. Ob der Herr Oberst das war, wissen wir nicht, aber ein rücksichtsloser, herzloser Mann, dem an dem Wohl oder Weh anderer nichts gelegen war, welchen auch die Vilshofener lange nicht vergessen konnten, ist er schon gewesen. Gleich bei seinem Eintritte überreichte ihm der Magistrat ein Douceur von 10 Karolin - 160 Reichsmark, nicht nur, dass er ein „gutes Kommando“, sondern auch in seinen Forderungen Maß halte.
Sie werden große Augen gemacht haben, wie er als monatlichen Servis oder als Gage von der Stadt für sich und seinen Stab 723 Gulden verlangt. Das sind mehr als 1200 Mark und doch begehrt er noch einen Zuschlag oder ein Douceur, wie sie es nannten, für jedes Monat von über 250 Mark. Sincère blieb 22 Wochen hier. Diese rechnete er, obgleich vier Wochen fehlten, schmutzigen Profits halber auf volle sechs Monate an. Der Servis machte die Kleinigkeit von fast 9000 Mark. Dem Weinwirt Johann Chrysostomus Peyrer zum weißen Rößl, wo der Oberst einquartiert war, hatte die Kammeramtskasse für den Unterhalt des Herrn de Sincère mit den Herren Stabsoffizieren und (dem) bei sich gehabten Kommando an Kuchel und Keller jene 22 Wochen durch 1293 Gulden 41 Kreuzer = 2217 Mark zu bonifiziren (vergüten). Wenn nur in jener Summe alles wäre begriffen gewesen! Aber da gabs nebenbei einen Konto von vier Metzgern mit 400 Gulden für Fleisch aller Sorten (dabei waren die 16 Gulden nicht für ein eigens vom Obersten bestelltes „hungarisches“ Schwein); weiters die Kontos zweier Mel ber mit 57 fl., der Bräuerkonto für 22 Eimer Bier mit 55 fl., der des Schreinerwirts oder Fischführers für 271 Pfd. böhmische Karpfen mit 53 fl., die Rechnungen der Kaufleute mit 211 Gulden für Baumöl, Gewürz, Limonien, Reis, Mandeln, Stockfische, Häringe, Zucker und Kaffee“ und endlich der Konto des untern Lebzelters (Stadtplatz 19) mit 153 Gulden für die verbrauchten Wachskerzen.
Verlorene Liebesmühe! Den Fähndrich suchte der Bürgermeister gleich bei der Ankunft durch ein schönes Trinkgeld zu gewinnen, dass bei der Hauswirtschaft, welche derselbe für den Obersten führte, nicht zu verschwenderisch umgegangen werde, und in gleicher Absicht hatte man auch dem Koch des Obersten einige Gulden zugesteckt. In der Fastnacht „mußte gemeine Stadt dem Obersten zu Ehren einen Ball veranstalten“. Aufgang für Wildpret, Konfekt, allerlei Wein und dergleichen 173 Gulden 29 Kreuzer Der Türmermeister erhielt, „umbwillen er (mit seinen Gesellen) beim Ball musizirte,“ 16 Gulden als Aufspielgeld.
Dass man den Obersten auf Kosten der Stadtkasse vierspännig nach München fahren lassen, dass man für ihn eine Reitschule anlegen, einen „hungarisch“ angestreiften (?) Reitzeug von starkem Messing, für sein Zimmer allerhand noble Einrichtungen anschaffen musste, dies wollen wir übergehen, nur eines noch! seine Hunde, Jagd- und Luxushunde! Es darf wundern, dass sie nicht mit lauter Fleischwerk gefüttert wurden, das übrigens reichlich von der Tafel abgefallen sein wird und aus der Bank wurde solches um 35 Gulden für sie geholt. Aber der Bäckerkonto für Hundebrot, dieser macht 217 Gulden Auch musste für die Bestien besonders geheizt werden.
Am 22. April 1744 schlug die Stunde der Erlösung für die Stadt an jenem Tage nämlich zog der Unhold ab. Schonung kannte auch nicht der für Vilshofen auf kurze Zeit von den Österreichern eingesetzte Pfleger Baron v. Ehrenburg, nachher Regimentsrat und Rentmeister in Landshut. Für die 20 Tage seiner Amtierung, vom 28. Mai bis 16. Juni, begehrte er von der Stadt je einen Dukaten, zusammen 85 Gulden, dann hatte er während dieser Zeit in einem Gasthause eine Zeche von 69 Gulden welche wieder im nächsten Jahre die Stadt zu bezahlen hat, aufgeschuldet, ferner, ich weiß nicht auf welchen Titel hin, nach seinem Abgange noch 51 Gulden sich nachschicken lassen.
Das kostbare Winterquartier zwang den Magistrat, eine wöchentliche Umlage von der Bürgerschaft zu erheben, welche von Ende November bis Ende April 6259 Gulden 41 1/2 Kreuzer abwarf. Man vergegenwärtige sich, dass der Geldwert ein höherer war und dass der einzelne Bürger daneben seine Quartierlasten zu tragen hatte. Die Kammerkasse war ohnehin beschwert genug, es hatte die Stadt im Jahre 1743/44 9430 Gulden (gerade so viel wie 1742/43) aufgenommen, unter denen 2000 Gulden (auch im vorigen Jahre die gleiche Summe) der reiche Schiffmeister Lukas Kern in Passau, der Gründer des dortigen mit großen Vermögen ausgestatteten Waisenhauses und anderer wohltätigen Stiftungen, geliehen hatte.
Von der gewöhnlichen Steuer war Vilshofen befreit, dagegen schrieb Prinz Karl von Lothringen, Höchstkommendierender der österreichischen Armee, vermöge „Mandats vom 18. Mai 1743 eine Kontribution im eroberten Lande Bayern aus.“ Marian Pusch setzt als Datum den 31. Mai und führt sie darauf zurück, dass dem eben genannten Prinzen der Schaden ersetzt werde, den er fünf Tage vorher bei dem Brande in einem Bauernhof nächst dem Kloster Osterhofen an Pferden und Equipage, auf 500000 Gulden gewertet, erlitten hatte. Von der Stadt Vilshofen begehrte man 860 Gulden, vom Hofe hieß es 30 Gulden, so dass die Stadt Vilshofen beiläufig 28 ganzen Bauernhöfen gleich geachtet war; doch begnügten sie sich mit dem Drittel, welches ebenfalls durch eine Umlage unter der Bürgerschaft gedeckt wurde. Für Kloster Niederalteich lautete der Anschlag auf 10000 Gulden.
Der Krieg dauerte nun schon in das dritte Jahr. Der Sehnsucht nach dem Frieden gab die Stadt Vilshofen durch Veranstaltung einer Prozession nach Mariahilf und einen solennen Amtes dort zu Ehren 252 der heiligen Jungfrau und nachgehendes eines zweiten in der Pfarrkirche zu Ehren des hl. Johannes des Täufers, um deren Fürbitte zu erlangen, Ausdruck. Die frommen Wünsche fanden nicht Erhörung.
Zwar ist Bayern während des Sommers nicht der Schauplatz des Krieges, das vaterländische Heer steht am Rhein und die Kämpfe werden im Elsass geführt. Eine Garnison war in Vilshofen nicht, aber dafür hatte es in ununterbrochener Reihe Truppenteile und Offiziere, welche sich zu ihren Regimentern begeben mussten, zu verpflegen oder aufs wenigste sie unterzubringen. Der Rat schickte den hiesigen Apotheker an den österreichischen Kriegskommissär nach Straubing, „um selben dahin zu vermögen, dass nicht alle Durchmärsche der hiesigen Stadt mit den Portionsgeldern zugewiesen werden möchten.“ Es hat wenig geholfen; Vilshofen an der großen Wasser- und an der Reichsstraße gelegen, war so leicht nicht zu umgehen. Hie und da bezahlten einzelne Abteilungen das Fleisch, aber zu einem niedrigeren Preise, als es die Metzger abgeben konnten. So leistete die Stadtkasse bei einer Einquartierung von Husaren ein Aufgeld von 3 Kreuzer per Pfund, das auf 6 Kreuzer stand. Es kam der Fall vor, daß als „die Metzger mit hinlänglichem Fleischwerk nicht versehen waren“ und den „Völkern“ solches bei dem Stiegenböck verraten wur de, sie dasselbe mit gar geringer Bezahlung hinweg nahmen, wofür die Kämmerer dem Eigentümer einige Ersetzung mit 12 Gulden gewährte. Sechs Wochen lang, vom 28. Juni bis 9. August war auch eine Werbestation hier.
Da der österreichischen Armee Proviant und Munition aus der Heimat geliefert werden mussten, treffen an den Stationen der Donau viele Schiffe von unter her ein, Zscheiken und ihre Bemannung, Zscheikisten genannt. Marian Pusch gedenkt derselben gar oft. Diese Fuhren machten häufig Beihilfe hiesiger Schiffer notwendig, mit einer Menge Ausgaben für letztere. Anfangs Mai 1744 hatte die Stadt auch vier Landfuhrwerke zum Transporte von Proviant nach Amberg und Grafenwöhr stellen müssen, wovon zwei aber nur bis Stadtamhof gelangten, mit einem Kosten von ungefähr 150 Gulden.
Da König Friedrich von Preußen im August 1744 den Österreichern den Krieg erklärte und auch wirklich in Böhmen einfiel, wurde die feindliche Armee nach diesem Lande berufen und es fand eine Bewegung der Österreicher vom Rhein her an der Donau abwärts durch Bayern statt, so daß letzteres von ihnen größtenteils geräumt wurde. Ihre Schiffbrücke wurde in Sicherheit zu bringen gesucht und sie kam am 22. September hier an; mit ihr das wandernde Hauptspital, bei dem sich nach Angabe des Niederaltacher Abtes bei 300 kranke und blessierte Soldaten befanden.“ Dem Kommandanten, Zscheikistenoberlieutnant Avini, verehrte der Rat bei seinem Eintreffen schon 12 Dukaten, dass er „gutes Kommando halten und auch das Krankenhaus abweg bringen möge.“ Dasselbe Douceur wurde ihm am 12. Oktober „wegen guten Kommandos und einstmaliger Hinwegbringung des Krankenhauses“ gereicht und wieder in gleicher Absicht für zwei Wochen ein Kuchelgeschenk von je 4 Dukaten am 19. Oktober gemacht. Am selben Tage wurden noch auf zwei großen Zillen Kranke nach Sandbach geführt, die vollständige Räumung des Spitales hier ging ohne Zweifel bis zum 23. Oktober vor sich, wo Avini auch unsere Stadt verließ. Das Spital wurde nach St. Nikola und später nach Linz verlegt.
Die Österreicher verproviantierten nun wegen der drohenden Gefahr die Festung Oberhaus ob Passau und versehen sie mit neuen Werken. Diese Kosten zu decken treiben sie Gelder ein; die Stadt Vilshofen hat hierfür 184 1/2 Gulden (der Gerichtsbezirk Hengersberg fünfhalbtausend Gulden) beizutragen. Auch fordern sie vorsichtshalber die Jahressteuern ab, von unserer Stadt über 1100 Gulden und nachträglich noch über 200 Gulden Quartiersbeiträge. Die Ausgaben wurden wieder durch Umlage in der Bürgerschaft aufgebracht.
Am 22. Oktober 1744, so erhält Prälat Marian von Niederalteich, kamen plötzlich alle Zscheiken (Militärschiffe) von Passau herauf in Pleinting an und lagerten sich auf dem dortigen Wörth (Insel unter halb des Marktes); sechs hiervon blieben in Vilshofen unter dem Kommando des Oberstlieutenants La Zamber als Besatzung. So schreibt Marian den Namen. Der Wüterich, eine Bezeichnung, welche ihm einmal in der Kammerrechnung beigelegt wird, hieß aber nicht La Zamber, - nach bloßem Hörensagen wird mancher ausländische Name verstümmelt, sondern Nagy Sandor, was aus dem Ungarischen übersetzt unseres Wissens Groß-Alexander bedeutet. Nagy Sandor muss schon gleich anfangs es arg genug gemacht haben, weil der hiesige Pflegsverwalter Pauer am 29. Oktober „bei Nacht und Neben wegen erlittener unbeschreiblicher Drangsale nach Niederalteich flüchtete.
Aus strategischen Gründen sollten die Mauern der festen Plätze oder Burgen in Niederbayern durch Minen gesprengt werden. Das geschah in Straubing, geschah in Winzer, Haidenburg, und sollte mit noch andern, unter diesen auch mit Vilshofen geschehen. Dass solches unserer Stadt in nächster Aussicht gestellt war, bezeugen zwei Posten in einer Rechnung jenes Jahres (1744): „die zwei Feuerwerker, welche die hiesige Stadtmauern sprengen und ruinieren sollten. verzehrten im Essen und Trinken in drei Tagen 3 Gulden 42 Kreuzer“ und „den zum Pulver und zugleich zur Sprengung der Mauern kommandierten vier Soldaten, als einem Korporalen 15 Kreuzer, den drei gemeinen Mann aber täglich 12 Kreuzer auf drei Tage bezahlt 2 Gulden 33 Kreuzer.
„Da in solcher Weise nicht allein die Bürgerschaft in die äußersten Ängsten geraten, sondern auch meist Häuser selbst in größter Gefahr gestanden, hat man, um solches abzuwenden, den 29. Oktober zwei Herren vom Rat von Seiner Exzellenz Herrn General Batthyany nach Schärding und von dannen nach Braunau und Burghausen abgeordnet.“- Marian Pusch lässt die Deputation an General Bernklau abgehen, der sich vielleicht an einem der beiden letztgenannten Orte aufhielt. Mit Einschluss von 30 Dukaten, die man des Batthyany Generaladjutanten spendierte (er hatte aber 100 begehrt), auf dass die erwirkte Einstellung des Vorhabens schnell expediert werde, erwuchsen in dieser Angelegenheit die Kosten auf 261 Gulden 44 Kreuzer.
Nun kommen wir auf Nagy Sandor zurück! Am 31. Oktober wollte er alle Häuser in der ganzen Stadt durchsuchen lassen, nachdem er sich ausgesprochen hatte, dass jedes, in welchem sich ein Gewehr befindet, angezündet werde. „Damit solche höchst bedenkliche Visitation unterbliebe, überreichte ihm der Rat zwei Dutzend Dukaten.“ Am 2. November 1744 überfiel ein bayerisches Kommando die hier gelegenen Zscheikisten, „tötete und verwundete mehrere und nahmen mehrere gefangen; ja es würden alle gefangen worden sein, hätte der bayerische Trompeter nicht zu voreilig geblasen.“ Die Zscheikisten wehrten sich verzweifelt. Die in Pleinting stationierten Zscheikisten kamen den hiesigen zu Hilfe und feuerten auf die lang sam abziehenden Bayern, jedoch ohne Schaden. Die Zscheikisten drangen wieder in die Stadt mit Einhauung des Mauttores (bei der Eigl’schen Lederei, Donaugasse 25), sprengten Haustüren und Kästen und plünderten. Am meisten wüteten sie in jenen Häusern, wo sie Leichen von den Ihrigen fanden, als bei Kaufmann Fallender (Stadtplatz 23), beim oberen Bräuer (ehedem Stockmaier, Stadtplatz 6, in den Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern, wo das Tagebuch des Abtes Marian Pusch abgedruckt ist, steht statt Bräuer: Bauer - und so mehrmals -, wohl durch Versehen des Herausgebers oder Setzers), in der Apotheke und noch anderen.
Hierauf ließ Nagy Sandor den Vizekämmerer Bäck Zaglmaier (Stadtplatz 5), den Weinwirt Schneider (Zierl) und den Stadtschreiber Braunschober holen und sie mit Wachen umgeben, ihnen bedeutend, dass die Stadt an den vier Ecken angezündet werde, wenn ihm nicht innerhalb zwei Stunden 5000 Dukaten für seinen beim Einfall der Bayern erlittenen Schaden eingehändigt werden. In aller Eile musste nun das Geld bei einzelnen Darlehen in Beträgen von 260 Gulden bis herab zu 20,30 Gulden aufgebracht werden, maßen die Wachen obbemeldete drei nicht mehr aus dem Gesichte ließ, sondern sie hin- und herführte. Um 9 Uhr nachts konnte man ihm 1821 Gulden 15 Kreuzer überreichen, womit er sich für den Augenblick scheint zufrieden gegeben zu haben, die Rückzahlung von Seite der Stadtkasse an die Darleiher erfolgte alsbald.
Des andern Tages begehrte Nagy Sandor von der Stadt, dass sie ihm die durch die Bayern fortgenommenen Gage- und Löhnungsgelder für den Monat November, welche er auf 1420 Gulden 30 Kreuzer anschlug. ersetzte. Man wendete ein, dass „man solches nicht schuldig und dass man ihm erst den Tag zuvor über 1800 Gulden habe geben müssen, sohin kein Geld mehr habe. Hat aber nichts geholfen! Er bezwang in aller Furie den eben anwesenden Nürnberger Boten und nahm von den bei ihm befindlichen Kaufmannsgeldern mit Erbrechung der Briefe und Säcke jene Summe heraus.“ Der Magistrat musste dem Boten eine Quittung ausstellen, in welcher er sich als Schuldner dafür bekannte.
„Nachgehends stellten sie ihm vor, daß es für die Stadt unerträglich falle, soviel Geld zu büßen.“ Er entgegnete: „Ich weiß wohl, es soll aus der königl. (österr.) Kasse hergegeben werden, es seien aber keine Mittel vorhanden; ich will Euch 255 Kufen Salz, die Kufe Salz per 3 1/2 Gulden und 44 Schäffel Malz, das Schäffel zu 12 Gulden gerechnet, welche hier als königliche Eigentum befindlich sind, überlassen, damit sind genau jene 1420 Gulden 30 Kreuzer gedeckt.
Aus dem Salz erlöste die Stadt, da man es teurer verkaufen konnte, 1015 Gulden 26 Kreuzer; das Malz aber verbrannte bei der Einäscherung der oberen Vorstadt kommenden Frühjahrs im fürstlichen Bräuhaus (Rentamtsgebäude), wo es aufbewahrt wurde. Eine geringe Einnahme war jene von 60 Gulden für die im Rathauskeller aufgefundenen, wahrscheinlich von einem österreichischen Marketender zurückgelassenen acht Eimer Branntwein; Bier und Branntwein hatten ohnehin die Zscheikisten vom 2.-7. November auf Kosten der Stadt für 78 Gulden getrunken.
Die Forderung des Nürnberger Boten befriedigte der Rat erst im nächsten Jahre, teilweise mit Kaisergulden, auf welche man, da andere Münzen nicht zur Hand, ein Aufgeld von je 2 Kreuzer - zu geben hatte. Von geringer Bedeutung sind die Nagy Sandors wegen von der Stadt gemachten Auslagen für sechs feine Hemden, für zweimalige Anschaffung von zwei Kaffeegeschirren, da ihm die ersten durch die Bayern bei ihrem Einfall genommen worden waren, für Leinwand, Tuch, Montur, Zucker und Kaffee, welche im bei der nämlichen Gelegenheit abhandengekommen waren, für Riemerarbeiten als Reitzeug, für Blechgeschirr und ein Sprachrohr, für geliefertes Brot oder dass ihn die Fischer am 6. November nach Passau zu Wasser führten. Er kehrte aber von dort wieder zurück und ehe er hier, um den Verfasser der Kammerrechnung reden zu lassen, „am 7. Nov. absegelte, begehrte er mit allem Rigor (Strenge) für seine bei obgemeldetem Scharmützel erlittenen Schäden von der Stadt noch 2000 Gulden, widrigenfalls er vier Bürger, welche er sogleich verwachen lassen, auf den Zscheiken mitnehmen würde.“ Den Bäcken Zaglmaier - dass dieser die zweimal und sonst noch ins vorderste Treffen kam, veranlasste seine Stellung als Kommunalverwalter - befahl er wirklich auf ein Schiff abzuführen, worauf man durch vielfältiges Bitten die Sache soweit gebracht, dass es sich mit 646 Gulden 3 Kreuzer abfertigen ließ; er setzte den Zaglmaier wieder auf freien Fuß und ist mit seinen Zscheiken fortgefahren. Wegen seiner Erpressungen spannte die Stadt nach geschlossenem Frieden beim ungarischen Generalauditoriat gegen den Unmenschen einen Prozess an, welcher vier Jahre lang verfolgt wurde und ein schönes Stück Geld (für die Reise zweier Abgeordneter nach Preßburg allein 137 Gulden) kostete, aber erfolglos blieb.
Pfarrer Klämpfl lässt sich in seinem Quinzigau also vernehmen: Oberst La Zamber - er schreibt also dem Abte Marian den Namen nach, welchen er nach den hier vorliegenden Aufzeichnungen nicht hat, - soll von der Stadt Vilshofen über 20000 Gulden erpresst haben. Der Vilshofener Stadtschreiber war in der Lage, den Tatbestand genau zu kennen, er meldet: „Nagy Sandor habe vermittelst seines unchristlichen Benehmens die Stadt unschuldiger Weise in einen Schaden von etlichen tausend Gulden gesetzt. „Am 8. November (1744), den Tag nach Nagy Sandors Abzug, rückte die Avantgarde der 40000 Mann starken bayerischen Armee in Vilshofen ein.
Unser Kurfürst, Kaiser Karl Albrecht, welcher den Oberbefehl führte, kam am 10. November hierher und blieb bis zum 20. Es war also unserer Stadt beschieden, in diesem Kriege ein zweites Mal das Hauptquartier aufzunehmen! Der Kaiser hatte seine Wohnung beim „untern Bräuer“ wieder heißt es irrig: „untern Bauern“. Wenn Marian Pusch, der so oft schon angezogene Verfasser eines Tagebuchs, welcher als Abt von Niederalteich beim Kaiser die Aufwartung machte, sagt: Selber sei dort eng logiert gewesen, so ist zu bedenken, dass die zwei Häuser, aus denen das Wieninger’sche Anwesen besteht. damals noch nicht zusammengebaut waren (Stadtplatz 20).
Wir schalten hier noch folgende Meldung des Abtes ein: Seine Majestät waren mit einem (sic) Uniform vom Leibregiment bekleidet, ohne Hut, sich lehnend an ein Tischl (der Kaiser litt am Podagra. er lebte nur mehr zwei, Pusch nur mehr vier Monate). Nachdem ich meine Gratulation und anderes vorgetragen, sagten Ihre Majestät mit annehmlichen Worten und Gebärden: Wir verlassen uns auf unsere Gerechtsame und das eifrige Gebet unserer Geistlichkeit, da hin wir uns auch rekommandiren. Wir nehmen die Drangsale und Schäden, welche Niederalteich getroffen haben, zu unserem gnädigsten Angedenken! Als der Prälat auf die noch fortwährenden Beunruhigungen des Klosters und der Umgebung durch die Feinde hinwies, meinte der Kaiser, es würde bald geholfen werden (!!).
Beim Kaiser befanden sich nebst seinem Hofstaat auch Gesandte, welche ihm aber schon am 18. November nach München vorangingen, und viele Generale, von denen wir Chaffat (über diesen bald mehreres) und die Feldmarschälle Törring und Seckendorfnennen, welch letzterer im „weißen Rößl“ einquartiert war und fünf Wochen hier blieb Im Rathausflur mussten Pferde eingestellt werden. Zwei Männer hatten mehrere Tage zu tun, um das häufige Kot in der Stadt und den Vorstädten zusammenzuschlagen und die Gassen allenthalben zu säubern. Zwei weitere Tagwerker standen 10, zwei andere gar 28 Tage auf Ordonnanz, besonders zum Botenlaufen. Enorm war der Holzverbrauch! Für die Quartiere des Kaisers, der Generale und der Gesandten mussten 70 Holzspalte-Tagelöhne ausbezahlt werden. Der Bürgerschaft ging das Brennmaterial aus; zudem mangelte es an Fahrgelegenheit. Deshalb kaufte der Magistrat vom General Chaffat 300 Floßbäume (a 45 Kreuzer), welche ohne Zweifel die Österreicher nicht mehr hatten fortführen können. Sie wurden unter die Quartiergeber, besonders die ärmeren verteilt.
Nach dem Abgang des Kaisers erst verließ das Gros seiner Armee, am 28. und 29. November, Vilshofen und bezog die Winterquartiere meist auf der rechten Seite der Donau. Marian Pusch tadelt es mit strengen Worten, dass man den bayerischen Wald entblößt gelassen, so konnte General Bernklau von Passau aus, — die Österreicher hatten ihre Linie von dort am Inn aufwärts bis in die Gegend von Riedmit einem Corps von 5000 Mann, mehrerenteils Kroaten und berittene Ungarn, vordringen.
In Vilshofen war eine ansehnliche Garnison, aus Bayern und Hessen bestehend und von General Chaffat kommandiert, zurückgelassen. Wenn nicht alsogleich, kam doch sicher am 13. Dezember das bayerische Freibataillon mit zur Besatzung hierher und war noch da bei Eroberung der Stadt am 28. März 1745. Dasselbe steht unter einem Major - wahrscheinlich kein anderer, als der ehemalige Gerichtsdiener Gschray, welcher sich bei der Verteidigung Straubings 1742 in hohem Grade hervorgetan hatte. Das Gray’sche Freikorps war beritten und vor 1744 auch ein hiesiger Wirtssohn, Anton Haas, demselben eingereiht.
chaffat
Fleisch und Brot brauchten die Quartiergeber den Soldaten nicht zu liefern. Letzteres wurde durch die im Hause Stadtplatz 36 einige richtete Militärbäckerei hergestellt; die Bäckerswitwe Föckerer erhielt, weil sie während der Zeit ihr Gewerbe nicht betreiben konnte, vom Magistrat Entschädigung. Dieser musste überhaupt armen Bürgern bei Anschaffung von Holz, Licht und dergleichen unter die Arme greifen und aber auch verschiedene allgemeine Ausgaben, z. B. — die für Wachskerzen in den Offizierswohnungen mit etwa 500 Gulden weitere 500 Gulden wurden den Untertanen des Pfleggerichts aufgebürdet — bestreiten. Dazu kamen die nicht bloß anstandshalber zu machenden Verehrungen".